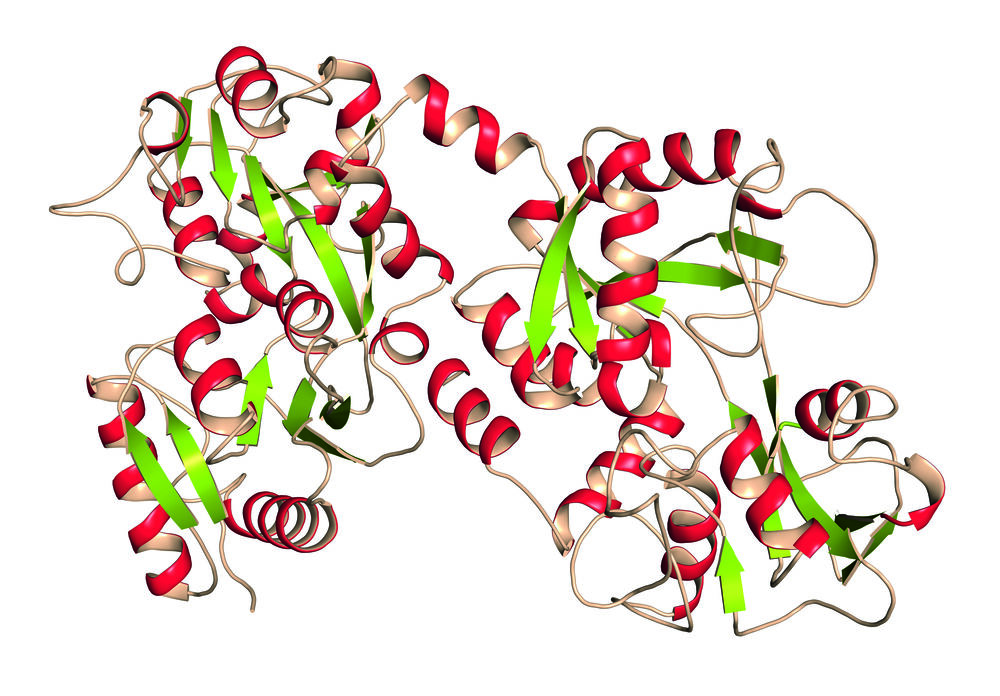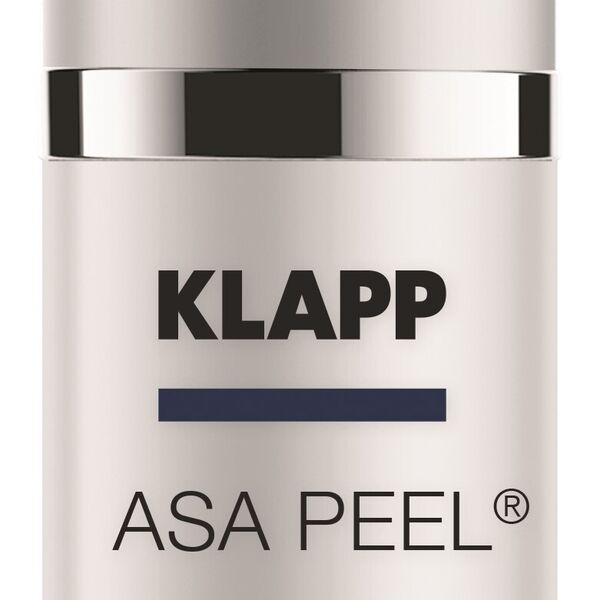Antimikrobielle Peptide
Wie Eiweiss-Einheiten helfen, Infektionen abzuwehren
Was hat ein Hühnerei mit Kosmetik zu tun, fragen Sie sich womöglich gerade? Ganz einfach: In vielen tierischen Organismen finden sich kleine Eiweissmoleküle, welche die Haut vor schädlichen Eindringlingen von aussen schützen können.
Säuren und Barrierelipide der Hornhaut (Stratum corneum), bilden die erste Verteidigungslinie der Haut gegen Infektionen. Sie sind aber auch die Basis für eine typische mikrobielle Besiedlung (Hautflora). Unter der Hautflora befinden sich nicht nur harmlose, sondern auch fakultativ pathogene Keime. Sie und andere äusserliche Keime werden beim Versuch, in die Haut einzudringen, durch Peptidstrukturen unschädlich gemacht.
Körpereigene antimikrobielle Peptide (AMP) sind essenzielle Bestandteile von Epithelien, d. h. den Grenzflächengeweben vielzelliger pflanzlicher und tierischer Organismen. Zu den zur Aussenwelt hin gerichteten humanen Epithelien gehören u. a. die Epidermis und die Schleimhäute der Augen, der Nase, der Mundhöhle, des Magen-Darmtraktes und der Vagina sowie die Epithelien der Harnröhre und der Lunge.
Effekt von Breitband-Antibiotika
AMP sind vor allem dann von Bedeutung, wenn die Epithelien verletzt und durchlässig sind. Denn dann wächst die Gefahr von Infekten. AMP sind ausserordentlich vielseitig und werden durch unterschiedliche Mechanismen aktiviert. Bei Entzündungen wird ihre Synthese stimuliert; darüber hinaus werden weitere AMP produziert. Anders als das Immunsystem greifen AMP Mikroorganismen unspezifisch an. Das bedeutet, dass sie wie Breitband- Antibiotika wirken. Die Aktivierung der AMP kann u. a. über den Kontakt mit Stoffwechselprodukten und Enzymen der Keime (z. B. Proteasen) erfolgen. Ein typischer Auslöser für die Bildung von Psorasin und Defensinen (AMP der Haut) ist das Flagellin, ein globuläres Protein, welches in den Bakteriengeisseln (Flagellen) vorkommt.
Ein anderes AMP, das Dermcidin (DCD), entsteht in den Schweissdrüsen und gelangt mit dem Schweiss an die Hautoberfläche. DCD-Fragmente, z. B. das DCD-1L, erzeugen Ionenkanäle in den Bakterienmembranen – mit der Folge, dass das Membranpotenzial zusammenbricht. Zinkionen wirken dabei synergistisch. Im Schweiss von Neurodermitikern, die häufiger an Infektionen leiden, kommt DCD-1L in vergleichsweise geringerer Konzentration vor.
Die Wirkungsmechanismen
AMP greifen Mikroorganismen in der Regel mit einem kationischen (positiv geladenen) Molekülrest an – indem sie in deren Membranen eintauchen. Somit sind sie entfernt verwandt mit synthetischen kationischen Konservierungsstoffen wie Chlorhexidin, Polyaminopropyl Biguanide (PHMB) und Quats wie Benzalkoniumchlorid. Auch das DCD-1L enthält neben anionischen einen kationischen Rest, der insbesondere im sauren Milieu des Schweisses aktiv ist. Der kationische Charakter der AMP entsteht durch die basischen Aminosäuren Arginin, Lysin und Histidin. Die Wirkung der AMP ist nicht nur abhängig von ihrer Ladung, sondern auch vom Verhältnis lipophiler und hydrophiler Bereiche in ihren Strukturen. Hier zeigt sich wiederum eine Parallele zu den Konservierungsstoffen der Kosmetikverordnung: Ihr Verteilungskoeffizient zwischen lipophiler und hydrophiler Phase einer Creme ist entscheidend für die antimikrobielle Wirkung. Eine wesentliche Eigenschaft vieler AMP ist ihre Fähigkeit, den Mikroorganismen für sie lebenswichtige Spurenelemente wie Eisen, Mangan und Zink zu entziehen. Dadurch legen sie deren Oxidoreduktasen lahm, die auf diese Schwermetalle angewiesen sind, und die Keime sterben ab.
Ein anderer Wirkungsmechanismus der AMP kann die Hemmung bakterieller Proteasen sein. Bei den Proteasen handelt es sich um Enzyme, die den Mikroorganismen dazu dienen, Proteine ihres unfreiwilligen Wirtes aufzuschliessen und zu verstoffwechseln. So können sie in ihn eindringen. Wie effektiv Proteasehemmer bei entzündlichen Prozessen sein können, kann man im Rahmen der Hautpflege z. B. beobachten, wenn Boswelliasäuren der Weihrauchharze als exogene Wirkstoffe eingesetzt werden. Sie wirken bei Akne, Rosacea, perioraler Dermatitis und infektanfälliger atopischer Haut antientzündlich.
Die Natur als Vorbild
Antimikrobielle Peptide sind in der gesamten Tierwelt verbreitet (siehe am Schluss) und je nach Spezies unterschiedlich aufgebaut. Auch Pflanzen schützen sich mit AMP gegen unerwünschte Infektionen. Sie setzen bei Verletzungen u. a. Substanzen frei, die die Synthese von AMP in Gang setzen. Leider lassen sich diese Stoffe nicht für die menschliche Haut nutzen. Das heisst, dass sie dort wirkungslos sind. Generell ist es aber eine elegante Möglichkeit, die Haut mit äusserlich applizierten Wirkstoffen dazu zu veranlassen, endogene peptidische Antibiotika zu erzeugen. Dabei handelt sich um vergleichsweise kleinere Moleküle als die aus vielen Aminosäuren zusammengesetzten AMP. Sie sind einfacher zu synthetisieren, stabiler und lassen sich unkompliziert einsetzen. Diese Art der Anwendung ist vergleichbar mit dem Prozess der Anregung endogener Wachstumsfaktoren durch von aussen appliziertes Vitamin A oder Vitamin A-Säure.
Obwohl die Entdeckung der ersten AMP bereits Jahrzehnte alt ist und viele biochemische Mechanismen bekannt sind, stehen entsprechende Entwicklungen aber noch ganz am Anfang.
Eine Reihe von klinischen Studien gibt es mittlerweile zu den peptidischen Antibiotika mit nativen AMP, synthetischen AMP-Analoga und modifizierten tierischen AMP. Sie haben nach wie vor den oben bereits erwähnten Nachteil der verhältnismässig komplexen Zusammensetzung. Die meisten konnten sich daher nicht durchsetzen – vermutlich aufgrund von hohen Herstellungskosten und ineffizienten Applikationsformen.
Eine Ausnahme bildet das Lactoferrin, welches u. a. in Milch vorkommt. In diesem Zusammenhang sind auch Beobachtungen interessant, welche die antimikrobielle und antivirale Wirkung (Warzen, Herpes) peptidhaltiger Schleime von verschiedenen Schneckenarten nahelegen. Diese Berichte decken sich mit Hinweisen aus der europäischen Volksmedizin.
Die richtigen Schlüsse
Was bedeutet das für die Hautpflege? Die bisher bekannten physiologischen Prozesse, die im Zusammenhang mit hauteigenen AMP stehen, zeigen, wie bedeutsam eine intakte Haut für die Prävention von Infektionen ist. Möglichst physiologisch sollte daher auch die Hautpflege sein, um Synergien und keine kontraproduktiven Effekte zu erzeugen. Ein Blick auf die Zusammensetzung von Kosmetika und Behandlungen zeigt, dass dies nicht immer der Fall ist.
- Eine übertriebene Hautreinigung begünstigt nicht nur trockene Haut, sondern führt auch zur Inaktivierung und zur Auswaschung hauteigener AMP. Die Folge ist eine gesteigerte Infektanfälligkeit gegenüber Bakterien und Pilzen (Mykosen). Dies gilt vor allem für die Verwendung von Emulgator- bzw. Tensidhaltigen Präparaten wie Shampoos oder Duschgels. Reines, weiches Wasser ist meist die bessere Wahl.
- Analog ist auch eine übermässige Reinlichkeit bei der Intimpflege im Besonderen und bei Schleimhäuten im Allgemeinen ein Faktor, der ernsthafte Störungen in diesen Bereichen auslösen kann und naturgemäss immer wieder Neuinfektionen verursacht.
- Starke Komplexbildner wie EDTA, die die Oxidationsstabilität von Kosmetika erhöhen, binden die Spurenelemente Eisen, Zink, Kupfer und Mangan, die für die Funktion der AMP essenziell sind.
- Über Jahre durchgeführte Peelings mit Fruchtsäure erhöhen die Anfälligkeit für periorale Dermatitis und Rosacea, bei denen anaerob lebende Bakterien ein wichtiger Faktor sind.
- Der unkritische Einsatz von Antioxidanzien dürfte ebenfalls das sensible Gleichgewicht der AMP beeinflussen.
AMP sind ein spannendes Hautpflege- Thema der Zukunft. Lassen wir uns von den Erkenntnissen überraschen!
Ein umfassender Schutz
Je nach Entstehungsort und Struktur wirken antimikrobielle Peptide (AMP) antibakteriell, antimykotisch, antiviral oder sind gegen Einzeller wirksam. Bedeutsam sind die folgenden Vertreter:
- Psorasin ist ein AMP, das in der Haut und insbesondere in Psoriasis- Läsionen vorkommt. Es ist gegen Escherichia coli (Darmbakterien) wirksam und wird durch das Flagellin der Bakterien stimuliert.
- Calprotectin ist ein AMP mit hoher Affinität zu den Spurenelementen Mangan und Zink. Durch Komplexierung dieser Elemente wirkt es antimikrobiell. Calprotectin kommt in den Granulocyten vor.
- Defensine befinden sich auf Haut und Schleimhäuten. Die AMP greifen vor allem cholesterinarme Membranen von Mikroorganismen und Viren an. Darm-Defensine lassen sich durch Probiotika stimulieren.
- Lysozyme kommen ubiquitär (überall verbreitet) im Tier- und Pflanzenreich vor und gehören zu einer grossen Familie von Enzymen des Immunsystems, die neben anderen Funktionen hauptsächlich gegen Bakterien wirksam sind.
- Cathelicidine befinden sich in Epithelzellen. Ihre Bildung wird endogen stimuliert. Chronische Hautkrankheiten wie atopische Dermatitis, Psoriasis und Rosacea zeichnen sich durch eine Fehlsteuerung dieser antimikrobiellen Peptide aus. Bei Rosacea entstehen die Störungen durch Cathelicidin-spaltende Proteasen. Dadurch werden fakultativ pathogene (krank machende) Bakterien begünstigt. In der Haut findet man dann vermehrt Cathelicidin-Fragmente.
- Dermcidin: entsteht in den Schweissdrüsen Lactoferrin enthält Eisen, hemmt verschiedene bakterielle Proteasen enzymatisch und kommt u. a. in der Milch und im Vaginalsekret von Säugern vor. Die effektive Behandlungsmöglichkeit von Paradontitis mit Lactoferrin ist beschrieben. Das aus Milch isolierte Enzym ist Bestandteil von Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika sowie naturgemäss von Produkten auf Milchbasis (z. B. Stutenmilch, Muttermilch).
- Ribonuklease-7 (RNase-7) ist ein hochwirksames AMP des Urogenitaltraktes und der Haut.
- Histatine kommen im Speichel von Säugern vor, enthalten die Aminosäure Histidin als kationisch wirkenden Bestandteil. Anwendung: Zahnfleischentzündungen (Histatin-Gel).

Autor:
Dr. Hans Lautenschläger studierte Chemie und Physik. Schwerpunkte seiner Tätigkeit bilden die Entwicklung und Anwendung von kosmetischen sowie von dermatologischen Präparaten. Nebenbei schreibt er auch für Fachmagazine.
KONTAKT:
koko@dermaviduals.de
Text: Dr. Hans Lautenschläger
Fotos: stock.adobe.com (2), Hans Lautenschläger (1)